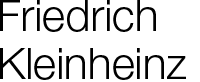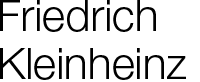| |
Ansprache
Johann Konrad Eberlein
Heidenheim, Waldfriedhof, am 23. 7. 2018
Liebe Gisela, lieber Harald de Bary, verehrte Trauergemeinde!
Wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von Friedrich Kleinheinz. Was heißt das eigentlich, Abschied? Ist es nicht so, daß in einem solchen Moment die Person, die uns zusammengeführt hat, über die Erinnerung, die Vergewisserung dessen, was sie uns bedeutet hat, eher wieder neu ersteht? Wird für unser inneres Auge nicht gerade das wieder lebendig, was ihre Stärke war, ihre Ausstrahlung, das Unvergeßliche? Wer ihn länger kannte, dem wird er immer als schlanke Gestalt gegenüber treten, groß, lebhaft, entgegenkommend, von einem idealistischen Feuer beseelt, das ihn als Figur in die Nähe der jungen Wahrheitssuchenden des Tübinger Stifts um 1800 rückte, wozu sein expressives Schwäbisch nicht unerheblich beitrug.
Und was heißt überhaupt Abschiednehmen bei einem Künstler? Ein Künstler stirbt nicht. Er lebt weiter in seinen Werken. Wenn wir an ihn denken, dann ersteht in uns zugleich das, was er geschaffen hat. Die Phantasie ist wortlos. Aber da seine Gebilde gewiß nicht alltäglich sind – wie wollen und können wir heute von ihnen reden?
Es ist kein einfaches Unterfangen. Sie wirken im ersten Eindruck absolut hermetisch, dabei streng, abweisend, zugleich auf schwer nachvollziehbare Weise durchdacht, jedenfalls radikal selbständig. Offenkundig ist ihre Verachtung des Gefälligen und seine Substitution durch das Erhabene, das Strenge.
Daher sind sie anstrengend. Der Betrachter wird gar nicht gefragt. Sie fordern seine grenzenlose Aufmerksamkeit. Sie überwältigen ihn bis zur Erschöpfung. Oft genug wurde ich Zeuge, wie Besucher das Atelier verlassen mußten, weil ihnen die psychische Kraft zur Aufnahme dieser Eindrücke ausging.
Damit sind Wirkungen benannt, die wir alle mehr oder weniger teilen. Noch nicht gefunden ist damit das Ziel seiner Kunst. Friedrich Kleinheinz war ein pictor doctus und konnte sein künstlerisches Bestreben selbst formulieren. Er ließ mir tatsächlich ganz am Ende über Gisela für diese Ansprache sicherheitshalber noch einmal Folgendes ausrichten: Als Maler sei ihm an der Auseinandersetzung mit den drei Primärfarben Rot, Gelb und Blau gelegen gewesen, dazu am Studium der Phänomene des Hell-Dunkel, wofür er, dem Wortlaut nach, noch Weiss nannte, nicht Schwarz, das seine späteren Werke fast ausschließlich bestimmte. Dieser Satz heißt zugleich: sonst nichts. Natürlich habe ich mich an diese Devise zu halten. Aber es macht bekanntlich seit den Homerdeutungen des Hellenismus das Können der Wissenschaft aus, schon Gesagtes stehen zu lassen und dann zu ihm noch etwas zu sagen. Begeben wir uns auf eine kurze Reise. Friedrich Kleinheinz ging es um Erkenntnisse über das Sehen. Von seiner Position als Künstler aus suchte er Antworten auf die Grundfragen nach den Veränderungen, denen die Farben, für die er die ungebrochenen Primärfarben nahm, unterliegen, wenn sie mit anderen kontrastiert werden, wenn verschiedene Grade von Hell oder Dunkel auf sie einwirken, wenn sie verborgen oder wenn sie enthüllt werden, also das Spektrum all dieser Möglichkeiten in der Natur und in der Kunst. Farbe ist immer subjektive Erscheinung und objektives Substrat zugleich. Mit seinen Bildern führte der Künstler das Immaterielle auf seine Entstehung im Materiellen zurück. Man kann es mit der alten Kinderfrage verdeutlichen: Wohin gehen die Farben, wenn es Nacht wird?
So und nicht anders sollen wir also seine Schöpfungen lesen. Das Gebot wirkt, wie gesagt, ausschließend. Er nennt keine anderen Ursachen für sein Ziel. Das ist möglich, weil die Begründung für das Tun des Künstlers durch ein höheres Gesetz legimiert ist. Es geht um Kunst, sonst nichts. Das ist eine sehr existenzielle Auffassung von Kunst, wie sie nur in der Nachkriegszeit möglich war. Heidegger variierend könnte man sagen: Die Kunst oder das Nichts. Die fundamentale Letztbegründung als Kunst erübrigte weitere Diskussionen, es kam nur darauf an, daß und vor allem wie dieses Ziel zu erreichen war. Innerhalb dieser übergeordneten Legitimation ging es Friedrich Kleinheinz um das Erkennen. Und da rückt die damalige Zeitsituation doch näher: Es braucht nicht ausgeführt werden, daß das richtige Erkennen als gesellschaftlich-politisches Ziel und sein Verschwimmen an den Rändern in der Zeit nach dem Nationalsozialismus ein beherrschendes Thema aller Diskussionen war. In der eigenen Familie des 1933 geborenen Künstlers spielte es eine faktische, bedrohliche Rolle, als der Vater nach 1945 zeitweise von seinem Posten suspendiert wurde. Die Fokussierung des künstlerischen Tuns auf das „richtige Erkennen“ stand sicher im Gleichklang mit den politischen Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit.
Gehen wir einen Schritt weiter und fragen von hier aus, woraus die Geschöpfe des Künstlers eigentlich bestehen. Da gibt es eine bestimmte Entwicklung. Der Künstler begann mit Zeichnungen in Schwarz auf Weiß, ging dann über zu ovalen Bildformen, die dem Ausschnitt entsprechen, den das Auge aus der vor ihm liegenden Welt herausschneidet. Er gab damit dem „Erkennen“ den richtigen physiologischen Rahmen des Sehens. Diese Scheiben waren zunächst wie herkömmliche Bilder bemalt, dann aber kam am Beginn der 80er Jahre die große letzte Phase, in der die Objekte aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt wurden. Das konnte tatsächlich fast alles sein. Die Auswahl war für den Betrachter unvorhersehbar. Einen gewissen Rahmen bildete höchstens die gemeinsame Herkunft der Dinge: sie waren meist Fundstücke. Auch dieses Vorgehen hat seinen historischen Ort in der Nachkriegszeit, als es darum ging, den Mangel an vielem durch die Nutzung von Gefundenem, noch Brauchbarem auszugleichen. Ganz Deutschland war damals eine Fundgrube. Die Kriegszerstörungen und das Nachkriegselend zwangen den Blick nach unten, auf den Boden, und in dieser Situation wurzelt die paradiesische Aura des Baumarkts, die bis heute die deutschen Männer fasziniert.
Gehen wir weiter: Was machte der Künstler mit seinen gesammelten Materialien? Auch hier kann man nur auf die Grenzenlosigkeit seines Tuns verweisen. Wieder für den Betrachter unvorhersehbar färbte, hobelte, fräste, wässerte, trocknete, durchbohrte, schmiedete, sott, schlug, vergrößerte, zerkleinerte er alles, was ihm zur Verfügung stand. Die vom Betrachter nicht ermeßbare, nur vom Künstler selbst quantifizierbare Investition von Material, technischem Aufwand und nicht zuletzt Zeit in die Objekte war singulär. Einmal versah er alte Backbleche mit Löchern. Es waren 36000. Der Aufwand folgte dem Ernst des Bemühens um die Sicherheit und Genauigkeit der künstlerischen Produktion mit einem handwerklichen Eigensinn, der nichts als das Selbstgemachte zuließ.
Jetzt mag es dämmern, daß die überwältigende Wirkung seiner Objekte nicht von irgendwoher kam, sondern ihre vom Künstler bestimmte Ursache hatte.
Halten wir kurz inne: Wir dürfen von seiner Vorgabe nicht abrücken. Das Interesse des Künstlers gilt den Primärfarben und dem Hell-Dunkel, sonst nichts. Was wurde daraus, als die Gunst der Zeit für ein derartig idealistisches Ziel schwand, als 1968 das Ende der Nachkriegszeit und ihres Kunstfundamentalismus eingeläutet und in den 80er Jahren vollzogen wurde? Bis dahin gültige Regeln wurden entwertet, die neuen Kunstwerke verkündeten das Ende der Kunst, Verantwortungen wurden abgeschüttelt, die familiären Ideale über Bord geworfen und das Gewissen blieb seither von den alten Ansprüchen unberührt.
Friedrich Kleinheinz selbst schien das bittere Schema des deutschen Männerlebens mit Krieg, Nachkriegszeit, Aufbau unter härtestem, auch körperlichem Einsatz und schließlich die Scheidung einzuholen, die bei ihm nach der Trennung im Jahr 1991 im Jahr 1998 vollzogen wurde. Auch wenn die eigene Position dieselbe blieb, sie wurde nun generell von außen beurteilt und die persönliche Verfügungsgewalt über ihre Grenzziehungen gegenüber den neuen Strömungen schien in Frage gestellt. Es ist mehr als eine nur chronologische Koinzidenz, daß der Künstler genau in dem soeben genannten Jahr 1991 damit beginnt, die eindrucksvollen schwarzen Objekte zu schaffen, deren Schwarz er jedes Mal noch durch Dunkel zu steigern versuchte.
Friedrich Kleinheinz überstand diese Krise, indem er sie nicht zu seiner eigenen werden ließ. Die strikte Eingrenzung der Vorgabe, an die wir uns zu halten haben, entfaltete eine neue Wirkung. Der Künstler bestimmte mit ihr die Rezeption seiner Werke. Er wandte sich gegen ihre mystische Auffassung, er widerstand der esoterischen Aneignung, sie sollen keine kosmische Dimension haben, nicht zur Meditation anregen, er untersagte die politische Deutung, er kappte damit jeden Zeitbezug. Sie sollten in ihrer hermetischen Abgeschlossenheit mit reiner und kalter Rationalität als Kunst wirken, nichts sonst. Man muß auch einmal andeuten, worauf er thematisch verzichtete: das Landschaftliche, das Pflanzliche, das Erotische, der Krieg, die Liebe, überhaupt der große Bereich des Geschlechtlichen. Die ganze ungeheure Bedeutung dieser Eingrenzung wird nun deutlich. Das Apolitische ist ihre gesellschaftliche Aussage. Friedrich Kleinheinz beharrte auf der Freiheit des Blicks, auf der Bedeutung des erkennenden Subjekts. Die Intention seiner selbstgestellten Aufgabe war nur unter dem Aufwand einer auch gelebten Gegenposition zu den antiindividuellen Strömungen der Zeit zu bewältigen.
Die hohe Investition von Arbeit in die Kunstobjekte und ihre Behandlung, die bis zur altarähnlichen Würdegebung reichte, war eine Aufwendung, in der die Selbständigkeit zur Aussage wurde. Seine Objekte waren Zeichen der Bewahrung früherer Ideale gegen die Auffassung von der Nutzlosigkeit des Gewissens. Seine Kunst bewahrte den Impetus der Nachkriegszeit, den Deutschen über Idealismus und schöpferische Produktivität eine neue, positive und allseits akzeptable Form der Daseinsbewältigung zu geben.
Dafür setzte er seine ganze Person ein. Er mußte so sein, wie er war. Ich schließe mit einer wunderbaren Aussage von Dante. Er traf im zweiten Buch seiner „Göttlichen Komödie“, dem purgatorio, im 15. Gesang, Vers 43 – 82, die Unterscheidung zwischen materiellen Dingen, die weniger werden, weil sie von einzelnen besessen werden, während Dinge mit einer Qualität, die jenseits des Materiellen liegt, mehr werden. Wer Geld hat, verbirgt es. Er wird einsam, habgierig und von Angst erfüllt. Wer Kunst beitzt, teilt diese mit anderen und vermehrt sie dadurch. Er gewinnt Freunde, mit ihnen diskutiert er über die Bilder und ihr Ruhm verbreitet sich.
Danken wir Friedrich Kleinheinz dafür, daß er in seinen Werken unter uns weiterlebt. Wir werden, immer wieder von neuem fasziniert, nicht aufhören, uns das, was er uns vor Augen gestellt hat, bewußt zu machen, in Worte zu fassen und so über sie zu diskutieren, als würde er uns zuhören und dabei gelegentlich den Zeigefinger heben: Es sind nur die drei Primärfarben, und dazu das Hell und das - Dunkel.
|
|