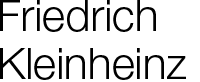
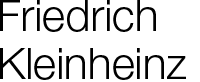
Anschauen, anschauen, und wieder: anschauen Von unserem Redaktionsmitglied Peter Schwarz, Waiblingen. Du kommst dir immer so blöd vor, wenn dir die moderne Kunst gegenübertritt. Du fühlst dich so rat- und ahnungslos, weil dir die vertrauten Einordnungs-Maßstäbe wegbrechen, die Argumente versiegen. Zugleich lauert untergründig dieser grobe Abwehrreflex, der nur darauf wartet, von der Leine gelassen zu werden: Bloß weil ich damit nichts anfangen kann, muss ich doch nicht blöd sein! Vielleicht ist die Kunst blöd! Will die mich verarschen? Ach was, die kann mich mal, die Kunst! So ringen Hilflosigkeit und Aufruhr um die Vorherrschaft. „Bildobjekte“ von Friedrich Kleinheinz in der Galerie der Stadt Waiblingen: Sie hängen nicht an der Wand, sie hängen von der Decke, an Stahlseilen im Raum, man kann sie umrunden, sie haben Vorder- und Rückseite. Der erste Eindruck: Monotonie. Eine riesige, mit Orange bestrichene Platte, die den Untergrund dunkel durchdringen lässt, trägt den Titel: „Orange über Dunkelheit“. Wie ein Ertrinkender klammerst du dich an den Künstler-Lebenslauf an der Wand: Jahrgang 1933; lebt in Zang auf der Schwäbischen Alb; und zwischen „1971-1975 Aufenthalt in Italien“ und „2000 Heirat in zweiter Ehe“: nichts. Die Botschaft: Willst du mehr wissen, schau dir die Bilder an. Nur: Kannst du das überhaupt noch, wo du doch tagtäglich bloß noch bewegte Bilder siehst, die dir dauernd davonrennen und von neuen ersetzt werden, Filmen, Reklamen, harten Schnitten, die ineinander purzeln – und deshalb musst du dich keinem einzigen dieser buchstäblich flüchtigen Eindrücke richtig stellen. Und nun stehst du da, und die Bilder machen sich nicht auf und davon. Schöne Bescherung. Ein Bild. Materialien: Eichenholz, Harzölfarbe. Feine Holzrippen, dicht an dicht, verlaufen von oben nach unten über die Fläche, 1,68 Meter lang, jede zwei Millimeter breit, sie wechseln sich ab mit ebenso breiten Fugen. Das Bild ist schwarz. Im ersten Moment. Es trägt den Titel: „Dunkel durch Schattenfugen verstärkt“. Tatsächlich: Das Schattenschwarz in den Fugen ist viel dunkler als das Farbschwarz. Und das Farbschwarz? Ist nicht „schwarz“, es glänzt, es hat einen Ton, den man gar nicht beschreiben kann, einen Moment lang scheint es weiß, aber weiß ist es auch nicht. Es ist ... nun gut, es ist so genannte „schwarze“ Farbe, auf die Licht und Schatten fallen. Und unter den hölzernen Rippen und Fugen: Es schimmert rot durch. Warum hast du das eigentlich nicht gleich bemerkt? Mehr als 200 Rippen – manche haben gebrochene Rücken, manche ragen weiter aus der Fläche, manche weniger weit. Wenn sich mehrere Rippen nebeneinander flacher ducken als der Rest, entsteht eine Bewegung, als laufe eine Welle über die Ebene. Du siehst Schrunden, Klüfte, Risse, die auftauchen und verschwinden, je nachdem, in welchem Winkel du dich zur Fläche stellst. Stehst du frontal davor, sieht es völlig anders aus, als wenn du zur Seite trittst und den Blick ganz schräg darauf fließen lässt. Und die Rückseite des Bildes? Das Gleiche. Nein, anders: andere Rippenkämme, andere Formationen von Schrunden, andere Lichteinstrahlung, andere Farbe. Und das Bild ... es hängt gar nicht völlig ruhig, es schwankt kaum merklich, wie ein Wolkenkratzer im Wind. Wie konntest du vorhin nur auf die Idee kommen, dass nichts geschehe auf diesen Bildern? So viel geschieht – bloß bist du es nicht wahrzunehmen gewohnt, weil du sonst nur die aufdringliche Bewegung der vorbeischnellenden Momentaufnahmen kennst und nie zu genau hinschauen darfst, weil du sonst, während du dem letzten Eindruck hinterherträumst, den nächsten verpasst. Und bei diesen Bildern musst du dir plötzlich wieder Zeit nehmen. Sie sind wie die Stille: Wer sich lang genug in ihr aufhält, hört tausend Geräusche. Manche Bilder sind mit Jute überspannt. Von ferne: öde Sackwände. Aus der Nähe: von der Farbe zusammengebackene Gewebeklumpen, von der Farbe drahthart gewordene Fäden, daraus hervorsplissende Fasern, immer weitere Verästelungen, ein Formenreichtum, den die Finger ertasten möchten, Licht- und Schattennischen. Du siehst mehr und noch mehr, und die Bilder wollen dich gar nicht mehr gehen lassen. Und was „bedeuten“ sie? Als Kind hast du nicht so gefragt. Du hast einen Stein in die Hand genommen, gedreht und gewendet, von allen Seiten studiert, ins Licht gehalten, mit Augen und Fingerkuppen erforscht, in die Hosentasche gesteckt und mit dir herumgetragen. Warum? Weil er da war; immer gleich und immer anders. Du hast nie gefragt, was der Stein „bedeutet“. Du rufst Museumsleiter Helmut Herbst an und lässt dir seine Vernissagenrede faxen. Herbst schreibt von diesem seltsamen Mann, der „ganz im Stillen auf der Schwäbischen Alb ein künstlerisches Werk geschaffen“ hat, „das zur Zeit nur wenigen bekannt ist, da er kaum ausstellt und sich nicht am Kunstmarkt beteiligt hat. Es war ihm einfach nicht wichtig, denn das Machen seiner Kunst nimmt die Priorität ein.“ Er tut, was „sein Leben seit langem bestimmt: Die Beschäftigung mit im Raum schwebenden Bildobjekten, die Erfahrung von Materialbeschaffenheit“ und „Farbe bei wechselnden Lichtverhältnissen“. Herbst nennt es „Wahrnehmungsuntersuchung“. „Was sich hier manifestiert“, schreibt Herbst, ist „von einer überwältigenden Existenzkraft beseelt. Es ist einfach da und strotzt vor Dasein“ ... Die Hilflosigkeit ist jetzt verschwunden und auch der Aufruhr. Weder bist du blöd, noch will die Kunst dich verarschen. Sie verlangt nur deine Geduld und deine ganze Aufmerksamkeit. Erschienen in der Waiblinger Kreiszeitung, 22. Januar 2005,
|